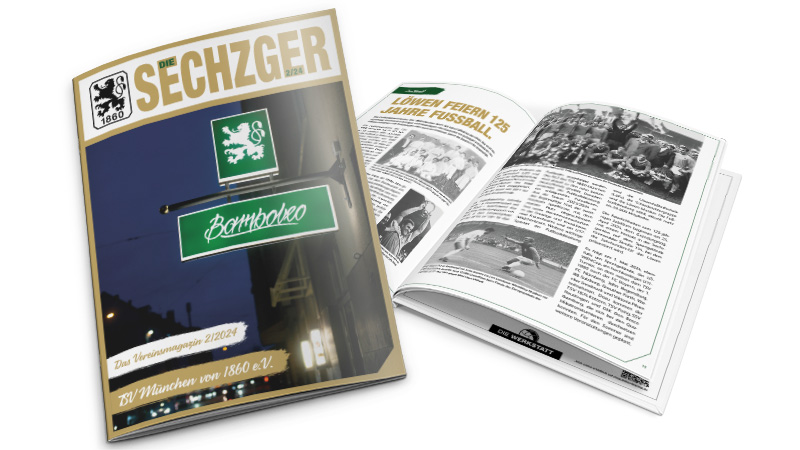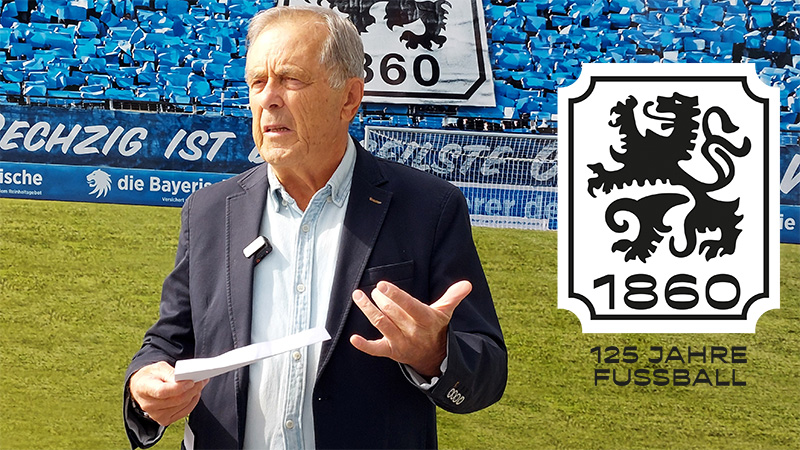Die Abteilung für Vereinsgeschichte veröffentlicht im Jubiläumsjahr jeden Monat einen Artikel zur Historie der Löwen. Diesmal befasst sich Anton Löffelmeier mit der Zeit zwischen 1914 und 1933 und der sportlichen sowie politische Geschichte Bedeutung der Sechzger.
Der Turnverein München von 1860 war in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zu einem führenden deutschen Turnverein herangewachsen, in dem auch die neuen Sportarten erfolreich betrieben wurden. Er konnte sich der Unterstützung des Königshauses, der Stadtspitze, der Stadtverwaltung und des liberal und national gesinnten Bürgertums sicher sein. Ein patriotisches Zeichen setzte der Verein, als er schon bald nach der Generalmobilmachung des bayerischen Heeres am 1. August 1914 aus Vereinsmitgliedern und anderen Turnern ein „Turner-Landsturm-Regiment„ zusammenstellte. Es sollte die Turner an der „Heimatfront“ für den Einsatz im Krieg vorbereiten. Der anfänglichen Begeisterung und Siegessicherheit wichen jedoch spätestens 1916 Ernüchterung, Hunger und Angst um die Angehörigen im Feld. Bei Kriegsende im November 1918 waren 137 Vereinsmitglieder gefallen und Bayern war mit der Proklamierung des „Freistaates“ durch Kurt Eisner am 8. November 1918 eine Republik geworden.
Die im April 1919 kurz nacheinander in München ausgerufen zwei Räterepubliken fanden bei der Vereinsführung der Sechzger keine Sympathien. Man stellte sogar Anfang Mai 1919 den Kämpfern des Freikorps Werdenfels, das sich bei der „Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung“ in Giesing mit besonderer Gewalt hervortun sollte, das Vereinsheim als Truppenquartier zur Verfügung. Den Einsatz der Werdenfelser bei der Niederschlagung der Räterepublik würdigte der Verein am 5. Mai mit einer kostenlosen Bewirtung.

Blick auf die Stehhalle des neuerbauten Stadions. Postkarte um 1926. (Stadtarchiv München, PK)
Am 20. Mai 1919 nahm man in allen Abteilungen den Betrieb wieder auf. Die Sport- und Trainingsanlagen an der Auenstraße wurden erweitert und der Platz an der Grünwalder Straße wurde mit Hilfe städtischer und privater Kredite zu einem modernen Stadion (Fassungsvermögen: 40.000 Zuschauer) ausgebaut. Am 10. Oktober 1926 wurde er offiziell eröffnet.
Allerdings führte die von der Deutschen Turnerschaft im Jahr 1923 vehement geforderte „reinliche Scheidung“ zwischen Turnern und Sportlern zur Ausgliederung der Fußball- und Leichtathletikabteilung in einen „Sportverein München von 1860“. Der Hauptverein wurde wieder in den „Turnverein München von 1860“ umbenannt. Beide Vereine konnten immerhin unter dem Dach eines gemeinsamen Verwaltungsrates zusammengefasst werden.
Die Mitgliederzahlen erreichten schon bald wieder das Vorkriegsniveau. Sie stiegen bis Ende der 1920er Jahre kontinuierlich an, sollten aber nach dem Börsenkrach vom 29. Oktober 1929 vehement einbrechen (1919: 2.696 Mitglieder, 1921: 3.782, 1930: 4.549, 1932: 2.898).

Ludwig Haymann (3. v. li.) als Mitglied der erfolgreichen Tauziehmannschaft des Vereins. (Stadtarchiv München, FS)
Damit war eine Dekade großen Wachstums und großer sportlicher Erfolge in Einzel- und Mannschaftswettbewerben zu Ende gegangen (s. auch Beitrag von Stepanie Dilba vom 17. August). Sportler*innen wie Maria Kießling (sie gewann bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften 1920 alle für Frauen ausgeschriebenen Titel), Elisabeth Gelius (sie zählte 1928 bis 1930 im 60- und 100-m-Lauf zur europäischen Spitze), Ludwig Haymann (er gehörte zu Beginn der 1920er Jahre zu den erfolgreichsten deutschen Leichtathleten und gewann 1928 als erster Münchner die deutsche Schwergewichtsmeisterschaft im Profiboxen), Xaver Geier (er sammelte in den Zwanziger Jahren als Ringer, Stemmer und Mehrkämpfer deutsche Meisterschaften en Masse), Josef Straßberger (er gewann 1928 als Gewichtheber die Goldmedaille im Schwergewicht und errang bis 1932 zwölf deutsche Titel) oder die Fußballnationalspieler Josef „Sepp“ Wendl und Ludwig „Pipin“ Lachner hatten den Namen des Vereins in die nationale und internationale Sportwelt getragen.

Ludwig „Pipin“ Lachner in Aktion. (Stadtarchiv München, AVBibl.-L-43)

Das schnelle Sprinterinnen-Quartett der Sechzger im Sommer 1930 (v. li.): Kellner, Karrer, Holzer, Gelius. (Stadtarchiv München, AVBibl.-L-43)
Die Öffnung der Turn- und Sportabteilungen für einen Wettkampfbetrieb bei den Mädchen und Frauen hatte insbesondere in der Frauenleichtathletik zu einer Leistungsexplosion geführt. Die 4-mal-100-m-Vereinsstaffel der Frauen stellte in den 1920er Jahren mehrmals Weltrekorde auf. Bei den Frauenweltspielen in Prag am 6. und 7. September 1930 erreichte die Staffel in der Besetzung Rosa Kellner, Agathe Karrer, Luise Holzer und Elisabeth Gelius als Nationalstaffel den ersten Platz (49,9 Sek.) vor England und Polen.
Im Sommer 1931 waren 40% der Mitglieder arbeitslos und die Einnnahmen aus den Spielen der Ersten Fußballmannschaft brachen ein. Seit 1932 konnte der Turnverein die aus dem Stadionbau herrührenden Zins- und Tilgungsbeiträge an die Städtische Spar- und Girokasse nicht mehr bezahlen. Heinrich Zisch (1869-1947), der langjährige Vorsitzende von Turnverein (seit 1924) und Sportverein (seit 1929), legte alle seine Ämter nieder. Die Wirtschaftskrise machte den Weg frei für eine Riege von Funktionären, die entweder bereits seit Jahren in der völkischen Bewegung aktiv waren oder sich von einer Liaison mit den Nazis die Rettung des Vereins erhofften. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, am 26. September 1933 beschloss die Hauptversammlung des Turnvereins die Umsetzung des Führerprinzips.
Teil 1: Die Gründung eines Traditionsvereins – 160 Jahre TSV München von 1860
Teil 2: Echt turnerische Brüderlichkeit
Teil 3: Die Stadiongeschichte(n) der Fußballer des TSV 1860
Teil 4: Der Verein wächst